Manche trugen Federn
Grzegorzki Shows zu Gast bei ERES Projects, zusammengestellt von Gregor Hildebrandt, Berlin
24. November 2022 – 25. Februar 2023
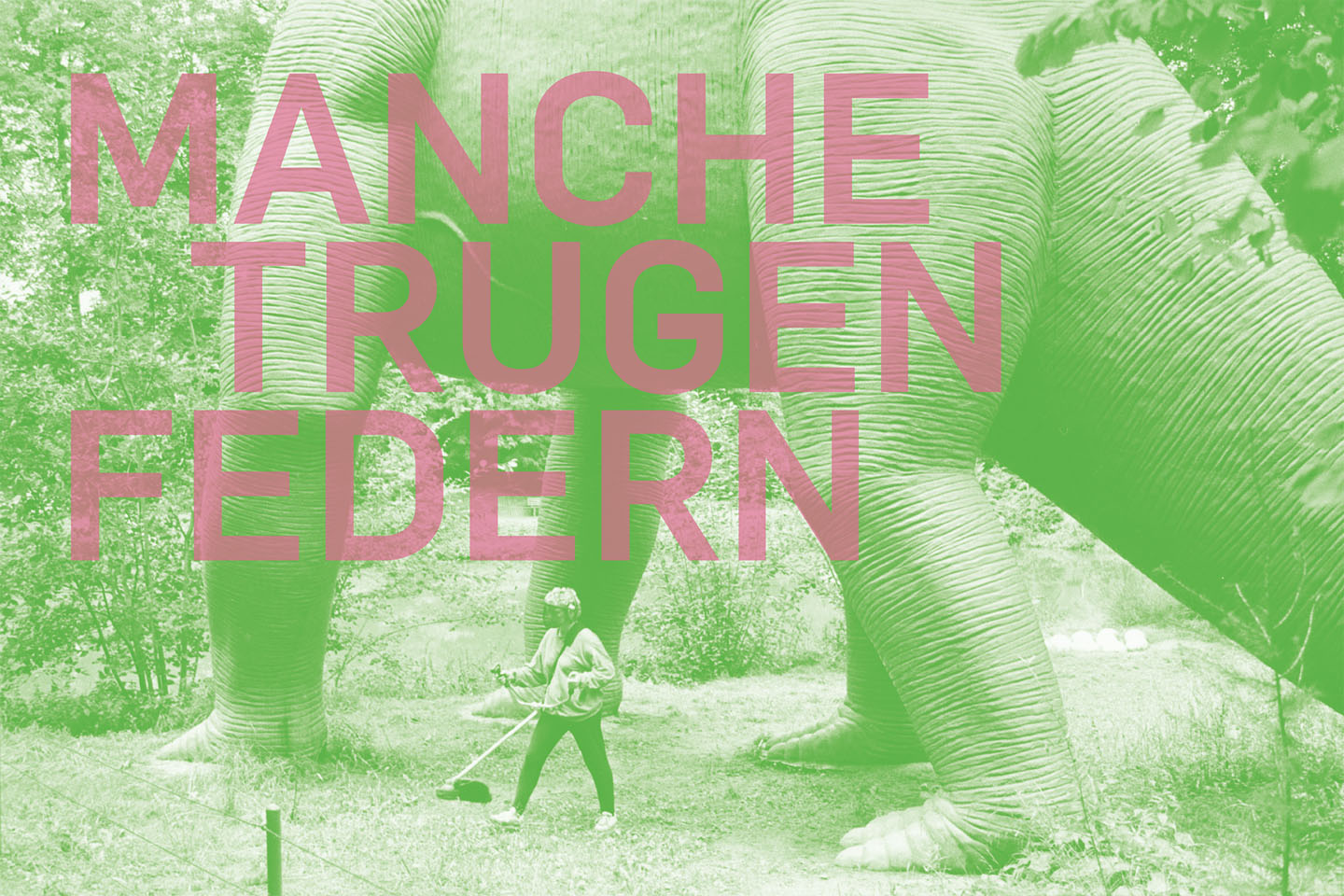
Videos
© München TV, Culture Talk, Markus Stampfl, 13. Dezember 2022
(Video: 198,8 MB)
Künstler
Sibylle Bergemann, Astrid Bauer, John Bock, Jean-Pascal Flavien, Moritz Frei, Gerrit Frohne-Brinkmann, Tine Furler, Isa Genzken, Gregor Hildebrandt, Mia Kleier, Alicja Kwade, Andy Hope 1930, Ida Tursic & Wilfried Mille, Stefan Rinck, Gerd Rohling, Anne Waak & Janne Gärtner, Jenny Rosemeyer
Ausstellung
Der Dinosaurier hat uns voraus, dass er es hinter sich hat. Die Klimakrise, das Artensterben, Krieg, sämtliche runden Geburtstage und Zahnarzttermine, alles schon passiert, vorbei. Dinosaurier bekommen keine E-Mails. Sie liegen unter Sedimenten und werden, wenn überhaupt, von den glazialen Zuckungen von Jahrmillionen bewegt. Ihre Existenz ist seit mindesten 66 Millionen Jahren eine horizontale, sie liegen hingestreckt, manchmal am Stück, manchmal in Fragmenten, in einem Bett aus Stein. Beneidenswert.
Dieses Es-ist-schon-alles-vorbei macht den Dinosaurier grundsätzlich sympathisch und beruhigend, egal, wie scharf seine Klauen und Zähne, egal, wie urgewaltig seine Glieder auch gewesen sein mögen. Dinosaurier existieren in so etwas wie einem realen Jenseits, das zu betreten uns auf ewig verwehrt bleibt. Dass sie doch einmal wiederauferstehen könnten, ist eine letztlich blasphemische Idee, die der amerikanische Autor Michael Crichton in einer Art postmoderner Frankenstein-Erzählung zum Welthit gemacht hat. Sie ist zum Glück unrealistisch. Falsch wäre sie schon aus Gründen des Artenschutzes – man kann es nun wirklich keinem Dinosaurier zumuten, das 21. Jahrhundert zu ertragen.
Kommen wir zum zweiten Paradox des Dinosauriers. Er ist uralt, aber in unserer Gegenwart eng mit der Kindheit verbunden. Kinder verstehen nicht, was Paläontologie oder was eine Steuererklärung ist, aber sie verstehen Dinosaurier. Fast alle Kinder lieben »Dinos«, auch wenn sie eigentlich grotesk aussehen und sich zum Kuscheln kaum eignen. Ganz schwer fällt es Kindern zu begreifen, dass die geliebten Wesen nicht nur nicht in ihrem Haushalt nicht wohnen können, sondern überhaupt nirgends mehr, auch nicht im Tierpark oder in Australien. Vielleicht ist das die erste kindliche Erfahrung mit Vergänglichkeit überhaupt. Irgendwann kommt es unvermeidlich zu einem traurigen Dialog:
»Wo können wir uns echte Dinosaurier ansehen?« »Hmmm, ja … nun.«
Das deutsche Wort »ausgestorben« ist eines, das man etwa gegenüber einer Vierjährigen ungern gebraucht. Was für ein Begriff: Es hat sich im wahrsten Sinn ausgestorben, der Tod selbst ist erschöpft und an seine Grenzen gekommen. Und doch ist er nicht das Ende. Die Dinosaurier leben ja doch unter uns weiter, man kann sie an vielen Orten auf der Welt besuchen, sie sind ein globales Kulturphänomen, dem man hinterherreisen kann wie einer Rockband.
Im vergangenen Winter habe ich das besterhaltene bekannte Skelett eines Tyrannosaurus Rex gesehen – »Sue« im Field Museum in Chicago, Illinois. Das Field ist ein gigantischer neoklassizistischer Kasten voller hölzerner Vitrinen, altmodischer Dioramen und ausgestopfter Tiere. Nichts lebt hier, alles ist konserviert oder nachmodelliert. Die berühmten Dinosauriergemälde von Charles Knight (1874–1953) füllen die Wände des Field, man kann dem Museumspersonal live beim Präparieren von Fossilien zusehen.
Das Beste aber ist vielleicht die an eine große Jukebox erinnernde Maschine namens »Mold-A-Rama« in einer Nische der großen Eingangshalle. Sie stammt aus einer Zeit, in der Konsum noch nichts Schlechtes war und Fortschritt ein unhinterfragtes Prinzip. Es war auch eine Zeit, in der man, was das Aussterben anging, noch der Meinung war, es handele sich dabei um einen graduellen Prozess, bei dem unfitte Arten verdientermaßen ausschieden. Auch Charles Darwin sah das so. Doch seit etwa 1980 wissen wir, dass er falsch lag. Die Dinosaurier beherrschten die Erde, als es sie hinwegraffte; Säugetiere waren bis dahin eine eher obskure Erscheinung gewesen. Die Dinos waren überaus gut angepasst, aber das hat ihnen nichts genützt, ein kataklysmisches Ereignis beendete ihre Existenz für immer. Was erdgeschichtlich betrachtet auch gar nichts Ungewöhnliches ist. »Solche Mega-Krisen«, schreibt der Paläontologe Paul B. Wignall in dem kurzen Band »Extinction – A Very Short Introduction«, »sind mittlerweile gut dokumentiert und haben der Geschichte des Lebens eine sehr viel zufälligere Anmutung verliehen als Darwin es sich je vorgestellt hatte«.
Was wird unser Asteroid sein? Das weiß keiner. Beim Mold-A-Rama jedenfalls handelt sich um eine »automatische Miniatur-Plastikfabrik«, die hinter Glas kleine grüne Brontosaurier zum Mitnehmen herstellt. Man bezahlt fünf Dollar, dann wird flüssiger Kunststoff über Schläuche in zwei metallene Formhälften geleitet, die nach kurzer Zeit zurückschnellen und den fertigen, schön glänzenden Dino fallenlassen.
»Make your own EXCLUSIVE PRODUCT molded in COLORFUL PLASTIC in seconds«, verkündet der Apparat. Der Mold-A-Rama, ein Renner auf der Weltausstellung von 1964 in New York City, verspricht nicht zu viel. Er ist selbst ein Fossil, mit seinen mechanischen Druckanzeigen, den leuchtenden warmen Eggleston-Farben und seinen beiden Displays, die wie Fernsehbildschirme wirken, aber eigentlich kleine Schaufenster sind mit dem realen Produkt darin.
Ich wurde Zeuge einer Auferstehung. Was nun warm und nach mittlerem 20. Jahrhundert stinkend in meiner Hand lag, war ein echter Dino, geformt aus der in Öl verwandelten organischen Substanz seiner untergegangenen Lebenswelt, wiederbelebt dank der Zuneigung von uns Menschen zu einer unendlich viel früher entstandenen Spezies. Einen vergleichbaren Apparat dürfte es für den Tasmanischen Tiger oder den Dodo nicht geben – es ist gerade die unüberbrückbare Distanz, die uns den Dinosaurier nahebringt. Und eines fernen und schönen Tages, dachte ich beruhigt und mit dem nun nur noch schwach riechenden Stück Plastik in der Manteltasche, werden auch wir vielleicht als nostalgische Souvenirs zu haben sein. Wenn wir es hinter uns haben.
Boris Pofalla
